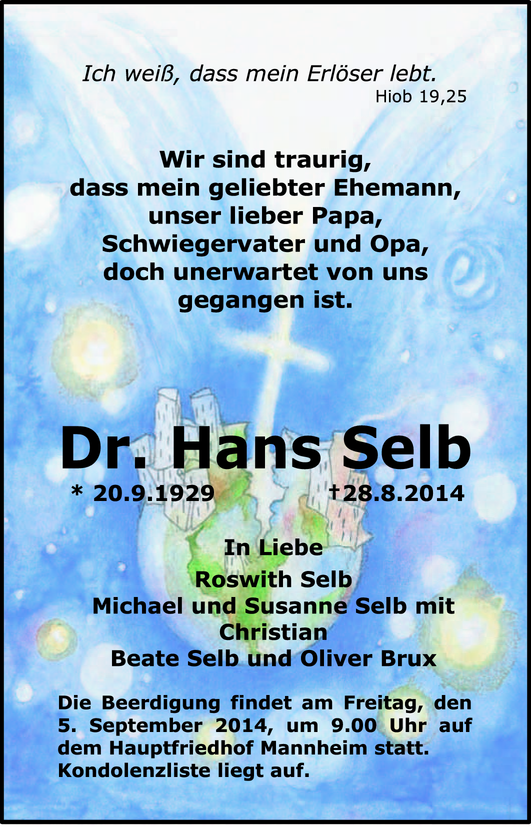| I Hans Selb 656 Hamburger Problem-Nachrichten IX-X/1950 |
|
#2 |
l. Df7? oder Dg7/Kf8? (droht 2. Db7#) Df2/Lf2/Sxb4 2. Sxd6/Sc3/Ta5#, 1.
... Lxb4!; 1.Dgl! (droht 2. Sc7#) Df2/Lf2/Sd4 (Se3)/c5/e3/f2 2. S:d6/Sc3/Sa3/Ld7/Ld3/
Df1#.
zu der Nr.5 meines Buchs ist vor ungefähr 50 Jahren entstanden und unter völlig
anderen Gesichtspunkten komponiert worden. Es ging mir damals nur um die sechs Varianten
mit Thema A. Wegen des zurechtstellenden Schlüssels, der sich bei diesem Schema wohl
nicht vermeiden lässt, wollte ich die Aufgabe eigentlich gar nicht in meine Auswahl
aufnehmen, bin aber jetzt froh, dass ich es doch getan habe, weil man anhand dieses
Stücks gleich drei Termini des Buchs erläutern kann, nämlich Variation, Ornamentik und
Teilsymmetrie.
| II Hans Selb 5 Ästhetik und Ornamentik2000 |
|
#2 |
l. Df7? oder Dg7/Kf8? (droht 2. Db7#) Df2/Lf2/Sxb4 2. Sxd6/Sc3/Ta5#, 1.
... Lxb4!; 1.Dgl! (droht 2. Sc7#) Df2/Lf2/Sd4 (Se3)/c5/e3/f2 2. S:d6/Sc3/Sa3/Ld7/Ld3/
Df1#.
Zunächst zum Begriff Variation, womit nichts anderes als das sonst gebräuchliche
"Version" gemeint ist: Der Ba6 in Diagramm I könnte in der Bearbeitung
entfallen, da 1. ...a5 die Drohung 2. Sc7# nicht pariert. Auf h7 sollte der König den
dreifachen Fehlversuch l. Df7 Dg7/ Dh7 einschränken, doch war dies wegen des
verbleibenden Duals nicht so wirksam wie die Versetzung des weißen Königs nach f7 und
der Dame nach g7 (Diagramm II), wobei zur Sperrung der Diagonale al-g7 lediglich ein sBf6
hinzugefügt werden muss. Damit ist nicht nur der Dual beseitigt, sondern auch mit l. Kf8?
ein attraktiver Trugschlüssel gefunden. Der Bh4 wurde nach h5 versetzt, weil ich aus
heutiger Sicht, wenn nicht wichtige Gründe dagegen sprechen, Steine lieber auf weißen
als auf schwarzen Feldern postiere.
Dann zur Ornamentik: Wie ich festgestellt habe, zeigt bereits die Urfassung alle einschlägigen Merkmale. Nur habe ich das seinerzeit nicht beachtet. Endpunkt dreier ornamentaler Figuren ist der schwarze König. Die Mattzüge des Lf5 bilden mit dem Mattfeld b5 das Quadrat f5-d3-b5-d7, die Mattzüge des Sbl ergeben zusammen mit demselben Mattfeld den Rhombus bl-a3-b5-c3. Hinzu kommt ein weiterer Rhombus durch die Züge des Se8 (Drohmatt 2. Sc7 und Matt 2. Sxd6 nach 1. ... Df2), nämlich e8-c7-b5-d6. Sbl, Kb5 und Lf5 sind die Eckpunkte eines rechtwinklig-gleichschenkligen Dreiecks, dessen Katheten von den weißen Bauern b3, b4 und d5 ergänzt werden und dessen Hypotenuse von Sc2 und Be4 nahezu ausgefüllt wird. Weniger leicht zu erkennen ist folgendes: Dadurch, dass die weiße Dame in der Variante 1. ...f2 das Feld f1 betritt, entsteht einerseits ein weiteres Quadrat (f1-b1-b5-f5), andererseits wird dieses Quadrat durch den Hinzug nach b5 in zwei weitere rechtwinkliggleichschenklige Dreiecke (f1-b1-b5 und f1-f5-b5) geteilt. Somit spielen bei dieser Aufgabe sämtliche Mattzüge im Hinblick auf die Ornamentik eine wichtige Rolle.
Schließlich zur Teilsymmetrie: Bei den Mattzügen des Lf5 ist die 5. Reihe die Symmetrieachse, bei denen des Sb1 die b-Linie und bei denen des Se8 die Linie e8-b5.
Ein Vergleich zwischen der Urfassung (Diagramm III)
| III Hans Selb Die Schwalbe 1960 |
|
#2 |
1. c4? (dr. 2. De4 oder Sd3#) Dxc4!; 1. Db3 (droht 2.
Te4#) Lb6/Lc6/Sf6 2.Ld6/Sg6/Lh6#, Nebenspiel 1. ... D pariert 2. S(x)d3#, 1. ...
Dc4/Dxe2/Sxg4(Sf3+) 2. Dxc4/Sxe2/T(x)f3#
und der Neufassung der Nr 18 meines Buchs (Diagramm IV)
| IV Hans Selb 5 Ästhetik und Ornamentik2000 |
|
#2 |
l. Lf5! (droht 2.Te4#)Lb6/Lc6/Sf6 2.Ld6/Sg6/Lh6#
Nebenspiel 1. ...D pariert 2. S(x)d3# 1. ...Dc4/Dxe2 2. Txc4/Sxe2#
zeigt, dass die Verbesserung nicht im thematischen, sondern im technischen und
ornamentalen Bereich liegt. Denn an den drei Hauptvarianten 1. ... Lb6 2. Ld6#, 1. ... Lc6
2. Sg6# und 1. ... Sf6 2. Lh6#, bei denen die gesamte Thematik einheitlich die 6. Reihe
betrifft, ändert sich nichts, wohl aber am Erscheinungsbild der ersten fünf Reihen.
Ausgangspunkt meiner Kritik an Diagramm III war die Tatsache, dass die starke weiße Dame
offensichtlich abseits steht und nur durch 1. c4 oder 1. Db3 ins Spiel gebracht werden
kann. Alle Versuche, diesen Mangel zu beheben, hatten lange Zeit keinen Erfolg, da die
Stellung sehr anfällig für Nebenlösungen ist. Als ultima ratio bot sich an, die weiße
Dame aus dem Spiel zu nehmen. Daraufhin ging alles überraschend schnell, und die
Neufassung war gefunden. Durch die Versetzung des Te2 nach c3 und den Wegfall des
thematisch nicht erforderlichen, ja eher störenden Sh2 konnten zwei andere Schwächen der
Urfassung beseitigt werden, nämlich die fehlenden Satzmatts nach 1. ... Dxe2 und 1.
...Sxg4. Statt dessen gibt es jetzt infolge der Versetzung des Lg4 nach c8 ein Satzmatt
nach 1. ...Dxc8, bei dem das Feld g4 von Weiß zurückerobert wird. Vor allem aber bietet
die Neufassung Ornamentik in Reinkultur: Den drei gemischtfarbigen Offizierspärchen auf
der 7. und 8. Reihe stehen die rein weißen Bauern- und Turmpärchen auf der 2.- 4. Reihe
gegenüber. Außerdem ist das Mattquadrat des Lf8 und der Rhomhus des Sc1 zu beachten.
Schließlich bilden die Standfelder der beiden weißen Läufer zusammen mit dem neuen
Schlüssel das rechtwinklig-gleichschenklige Dreieck c8-f'8-f5. Daneben haben noch die
beiden Turmmatts ornamentalen Charakter.
| weiter |